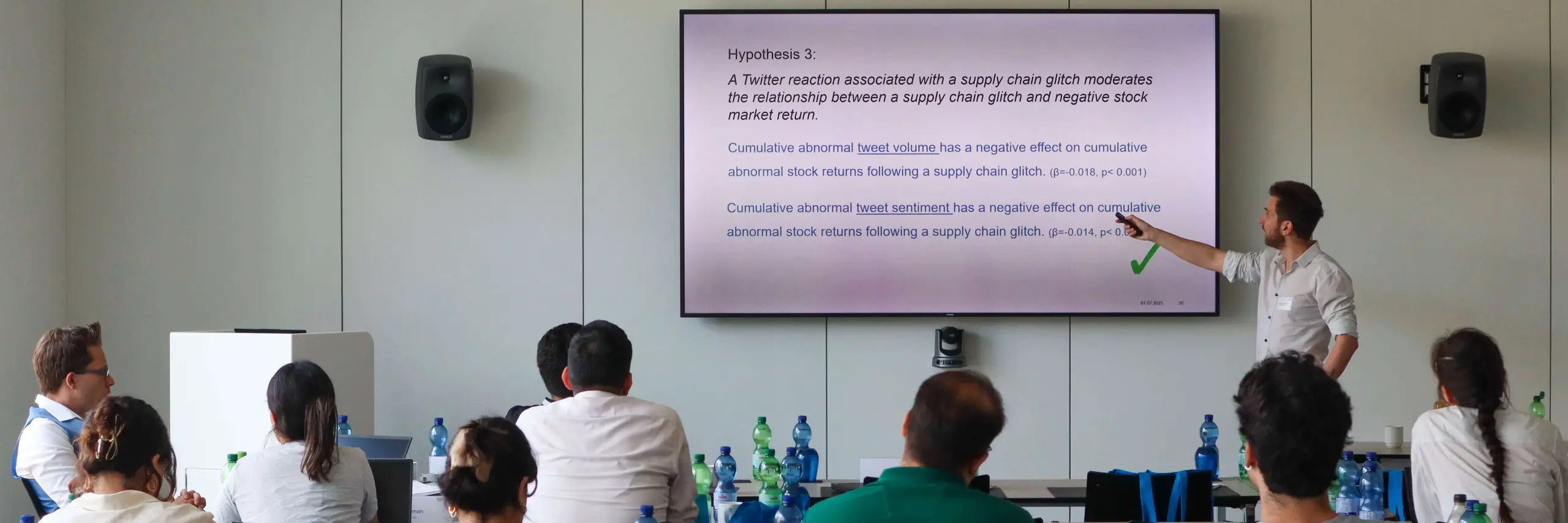Unter dem Motto „Of tariffs and tensions: SCF for resilient supply chains“ versammelte der 7. SCF-Hub am TUM Campus Heilbronn Expertinnen und Experten aus Industrie, Wissenschaft und Finanzwirtschaft – online und vor Ort. Im Vorfeld fand mit der „Supply Chain and Finance Week“ ein mehrtägiger Austausch der internationalen Forschungsgemeinschaft im Bereich Supply Chain Finance statt.
Zölle belasten den Cashflow
Im Fokus des 7. SCF-Hubs stand eine neue Realität: Zölle belasten die globalen Lieferketten und erhöhen die Handelsrisiken. Tarife von bis zu 50 Prozent des Warenwerts entziehen den Lieferketten Liquidität, schmälern die Margen und steigern die Volatilität von Nachfrage und Angebot: „Zölle sind mehr als politische Instrumente, sie wirken wie strukturelle Schocks“, betont Gastgeber Prof. Dr. David Wuttke, Professor für Supply Chain Management am TUM Campus Heilbronn. Sein Fazit: „Lieferkettenfinanzierung beseitigt zwar nicht die Ursachen, kann aber die Folgen der Zollkrise dämpfen.“
Beim Supply Chain Financing erhalten Lieferanten ihr Geld deutlich vor Fälligkeit der Rechnung. Dritte übernehmen die Zwischenfinanzierung, während Kunden die üblichen Zahlungsziele von 60 oder 90 Tagen nutzen. Zölle hingegen werden sofort beim Import fällig und verschieben den Cashflow. Hier stoßen klassische SCF-Modelle an Grenzen. „Standardisierte Lösungen für ein spezielles Tariff-Financing fehlen bislang“, bemerkt Wuttke.
Regionalisierung senkt Risiken
„Am Ende zahlen die Endverbraucher die Zölle“, erklärt im Expertenpanel Dr. Alexander Regelmann, Head of Center of Expertise beim Spezialchemieunternehmen Clariant. Seine Beobachtung: „Viele Lieferanten können die Belastungen in der Lieferkette nicht mehr allein tragen und versuchen die Kosten entlang der Lieferkette weiterzugeben.“ Clariant wiederum setzt in Europa, China, den USA und in Lateinamerika weitgehend auf lokale Lieferketten. „Das reduziert die Kosten und Risiken deutlich“, so Regelmann.
Doch Nearshoring ist nicht überall möglich – auch das zeigte der SCF-Hub. Die Komplexität vieler Lieferketten verhindert schnelle Anpassungen. Viele Netzwerke sind über Jahre gewachsen.
Weil die Unsicherheiten zunehmen, gewinnen die Vertragsbedingungen an Bedeutung. Härteklauseln sowie Regelungen im Fall höherer Gewalt oder bei Gesetzesänderungen werden wichtiger: „Wer das Risiko der Einführung neuer Zölle trägt, muss im Einzelfall klar definiert werden“, betont Dr. Jan Conrady, Partner bei der Kanzlei Clifford Chance.
SCF bringt Liquidität in die Lieferketten
Supply Chain Finance kann Handelsbeziehungen stabilisieren, indem es für Lieferanten und Kunden finanzielle Spielräume schafft. Initiatoren sind die einkaufenden Unternehmen. Die Finanzierung erfolgt durch Banken und Investoren. Spezialisierte Provider und Plattformen treten als Vermittler auf. Künstliche Intelligenz unterstützt das Risikomanagement: „Die Analyse von Fracht- und Zolldaten, Liquiditätskennzahlen und Lieferanten-Indizes ermöglicht es, SCF-Programme zu optimieren und Risiken auch in tiefen Lieferketten sichtbar zu machen“, erklärt Karel Krejčí vom KI-Spezialisten Calculum.
Klassische SCF-Angebote wie das Reverse Factoring brauchen Zeit, Transparenz und das Vertrauen aller Beteiligten: „Firmen mit bestehender Lieferkettenfinanzierung sind im Vorteil. Sie können ihre Programme flexibel und kurzfristig ausweiten“ sagt Lena Stelzner, Sales-Direktorin von CRX-Markets. Sie warnt davor, SCF allein als Werkzeug zur Optimierung des Working Capital zu sehen: „Lieferkettenfinanzierung erfordert bereichsübergreifendes Denken und ist nicht allein Sache von Treasury.“ Vor allem der Einkauf müsse eingebunden werden. Schließlich tritt er mit dem Angebot an die Lieferanten heran.
Neue Modelle für Krisenzeiten
Seit einigen Jahren existieren Alternativen. „Einfache, schnelle Lösungen für Krisenzeiten, in denen es schwierig ist, Zahlungsziele mit Lieferanten zu verhandeln“, beschreibt Stelzner die Finanzierungsmodelle ohne Lieferanteneinbindung. Dabei beauftragt ein Unternehmen einen Zahlungsdienstleister, den Lieferanten wie üblich bei Fälligkeit zu zahlen. Der Zahlungsdienstleister räumt dann dem Unternehmen ein zusätzliches Zahlungsziel ein, welches über Dritte zwischenfinanziert wird. „Anders als die klassischen Programme dienen diese Lösungen der reinen Cashflow-Optimierung“, verweist Wuttke auf den Unterschied.
Als Pionier im Supply Chain Finance gilt Siemens. „Lieferkettenfinanzierung braucht eine Systemperspektive“, weiß Friedemann Kirchhof, Leiter Supply Chain Finance bei Siemens. Siemens überlegt, wie durch KI gestützte Datenanalyse das Finanzierungsangebot in der Lieferkette ausgeweitet werden kann. Derzeit analysiert der Konzern, welche Lieferanten von Zöllen betroffen sind, und schafft Transparenz. „SCF schützt nicht vor Zöllen, macht aber die Lieferkette robuster, indem es Liquidität bereitstellt“, betont Kirchhof in Heilbronn.
Andere Unternehmen zögern: „Wenn wir über Unsicherheit sprechen, denken wir oft an Cashflow-Risiken. Doch Unsicherheit bremst auch strategische Entscheidungen“, erklärt David Wuttke. „Die Unternehmen fragen sich: Sieht meine Lieferkette morgen noch genauso aus – oder verhandle ich Zahlungskonditionen bald mit anderen Lieferanten?“ Der Wissenschaftler rät in der Zollkrise aktiv gegenzusteuern und das strategische Instrument Lieferkettenfinanzierung gezielt zu nutzen: „SCF kann kurzfristige Liquiditätsengpässe wirksam abfedern.“